Die Polyvagal-Theorie einfach erklärt: Das Nervensystem als Schlüssel zu gesunder Führung
Wenn du wissen willst, wie neuro-basierte Führung wirkt, dann wirf mal einen Blick auf die Erkenntnisse dahinter. Wichtige Grundlagen hat uns die sogenannte Polyvagal-Theorie geschenkt. Klingt schrecklich, aber ist ein Segen.
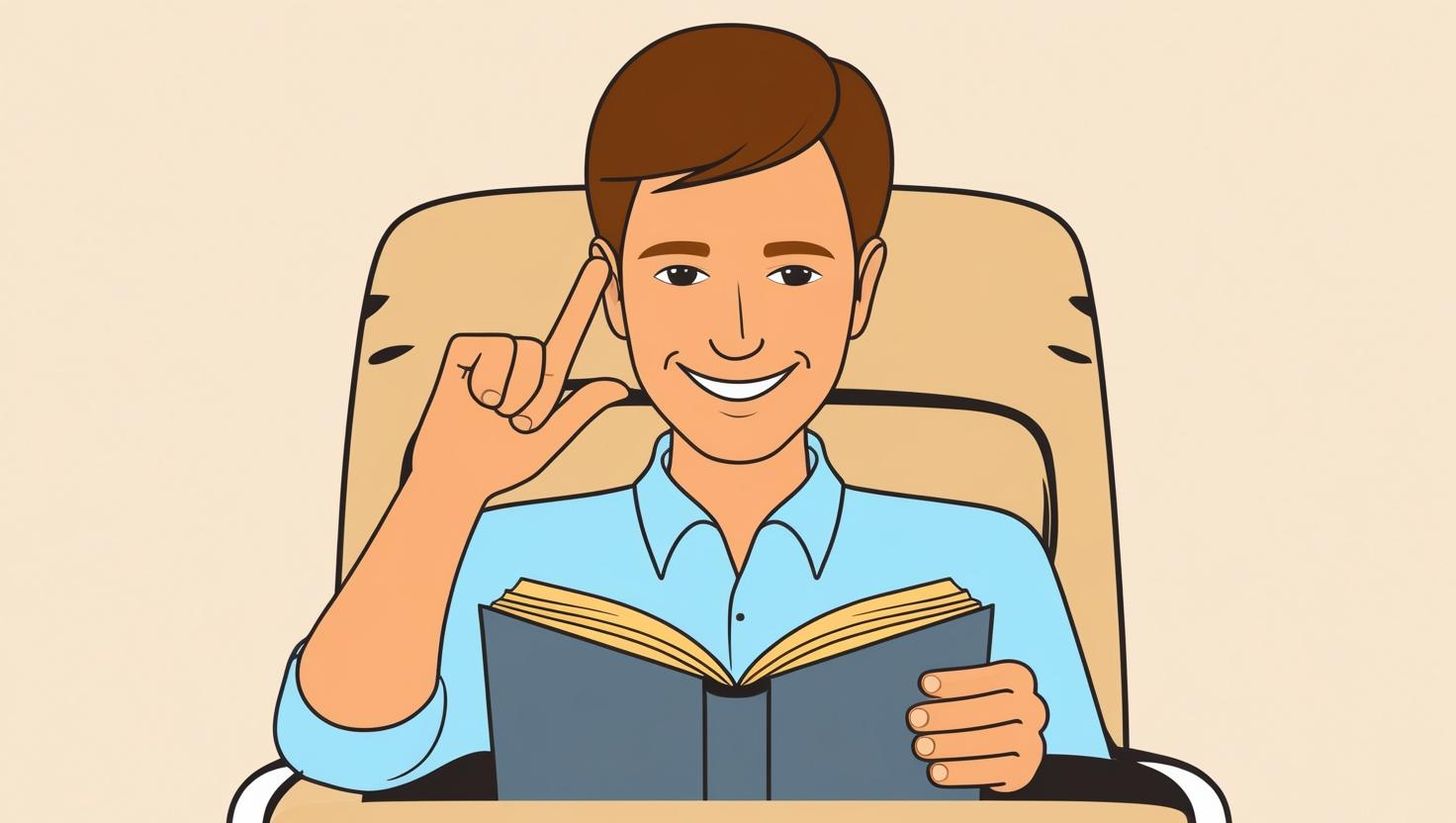
Wie unser Nervensystem unser Verhalten bestimmt
„Poly… was?“ – Ich muss zugeben, der Name ist ziemlich sperrig. Doch was sich hinter der Polyvagal-Theorie versteckt, hat mein Führungsverständnis maßgeblich verändert. Diese von Dr. Stephen Porges entwickelte Theorie ist so was wie die „Betriebsanleitung“ für unser autonomes Nervensystem. Sie erklärt, warum Menschen in manchen Momenten kreativ und kooperativ arbeiten können, während sie in anderen Situationen komplett neben der Spur stehen. Das Schöne daran: Wenn du die Grundlagen verstehst, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten der Führung.
Erkenntnis #1: Das Nervensystem sucht Sicherheit
Unser autonomes Nervensystem scannt permanent unsere Umgebung nach Gefahr und entscheidet blitzschnell – meist völlig unbewusst – ob wir uns sicher fühlen können oder nicht. Diese „autonome“ Entscheidung bestimmt dann unser Verhalten: Ob wir offen und kreativ sein können oder in einen Überlebensmodus schalten. Das erklärt, warum wir manchmal – trotz bester Absichten – nicht so reagieren können, wie wir eigentlich möchten.
Der Kollege, der gegen jeden Vorschlag ist? – Er befindet sich in einem Überlebensmodus (fight). Die Kollegin, die das ganze Meeting über nichts sagt, obwohl ihre Expertise wichtig wäre? – Auch sie steckt in einer Art Schutzmodus (freeze).
Erkenntnis #2: Das Nervensystem sucht Bindung
Als Mensch suchen wir von Natur aus die Bindung zu anderen. Alleine wären wir in der Steppe früher nicht überlebensfähig gewesen. Unser evolutionärer Vorteil war die Kooperation in Gruppen. Das liegt also in unserer DNA und wird dadurch verstärkt, dass wir auch in den ersten Lebensjahren alleine nicht überlebensfähig wären. Bindung sichert also unser Überleben.
Die entscheidende Kombination: Sicherheit durch Verbindung
Was wir bei Mitarbeitenden als „schwieriges Verhalten“ oder als Charaktereigenschaft interpretieren, ist oft nichts anderes als ihr Nervensystem, das entweder auf wahrgenommene Bedrohung reagiert oder verzweifelt versucht, sichere Verbindungen herzustellen. Erst wenn beide Grundbedürfnisse – Sicherheit und Verbundenheit – erfüllt sind, können Menschen ihr volles Potenzial entfalten. Das gleiche gilt für uns selbst übrigens auch!
Die 3 Betriebsmodi unseres Nervensystems
Je nachdem, welche Reize unser Nervensystem wahrnimmt und wie es eine Situation bewertet, werden bestimmte Nervenbahnen aktiviert – weil da der sehr verzweigte Vagus-Nerv wichtig ist, spricht man übrigens von „Poly“vagal.
Der safe&social-Modus
Wird die Umgebung als sicher eingestuft, sind wir offen, lebendig und kontaktbereit. Unser Großhirn ist kreativ und leistungsfähig, wir sind konstruktiv im Miteinander – der Idealzustand für jedes Team. Nice oder?
Der fight&flight-Modus
Bei wahrgenommener Gefahr schaltet unser System in den Überlebensmodus. Wir werden angespannt, reizbar, fallen anderen ins Wort und denken in Schwarz-Weiß-Mustern. Logisches Argumentieren wird schwierig, weil wir in der Abwehr sind. Konstruktives Miteinander wird schwierig bis unmöglich.
Der freeze&fawn-Modus
Im Shutdown-Modus wirken Menschen wie erstarrt oder abwesend: leerer Blick, leise Stimme, kaum Augenkontakt. Das Denken wird neblig, Entscheidungen fallen schwer. Emotional sind Menschen in diesem Zustand kaum erreichbar. Eine erste Form davon ist beispielsweise Dienst nach Vorschrift.
Erkenntnisse für Führungskräfte
Für dich als Führungskraft ist dieses Wissen eine Menge wert: Es erklärt, warum übliche Führungsreflexe („mehr Kontrolle, noch mehr Fokus auf Details und Prozesse, …“) oft das Gegenteil bewirken. Stattdessen zeigt die Theorie: Wer das Nervensystem seiner Mitarbeitenden versteht, kann Bedingungen schaffen, unter denen Menschen eigenverantwortlich ihr volles Potenzial entfalten. Nur wenn Menschen sich wirklich sicher fühlen, haben sie überhaupt Zugang zu ihren besten Fähigkeiten.
Mit etwas Übung erkennst du von außen übrigens sehr gut, wer gerade in welchem Zustand steckt.
Reflexionsfragen für dich:
- In welchen Zuständen erlebst du dein Team derzeit?
- Schau mal von oben auf dich selbst – wie erleben deine Mitarbeitenden dich?
- Was könnte von deinem Team als unsicher wahrgenommen werden?
Konkrete Ansätze für die Praxis
Aller Anfang liegt bei dir
Als Führungskraft bist du der wichtigste „Sicherheits-Sender“ in deinem Team. Deine Mitarbeitenden scannen – meist unbewusst – permanent dein Verhalten, deine Mimik, deine Stimme. Nur wenn du selbst einen guten Zugang zu deinem safe&social-Modus hast, kannst du andere dorthin begleiten. Das bedeutet:
- Lerne deine eigenen Nervensystem-Zustände kennen
- Identifiziere deine Trigger für fight&flight oder freeze
- Entwickle Techniken der Selbstregulation
Ja, diese Selbstreflexion ist Arbeit, die sich aber in allen Lebensbereichen auszahlt.
Sicherheit im Team etablieren
Als „Sicherheits-Anker“ im Team kannst du durch drei Arten von Klarheit wirken:
1. Strukturelle Klarheit
- Verlässliche Meeting- und Entscheidungsstrukturen
- Transparente Informationsflüsse
- Klare Meilensteine und definierte Ansprechpartner
2. Beziehungsklarheit
- Regelmäßige 1:1-Gespräche und Team-Dialoge
- Wertschätzende Feedback-Kultur
- Frühzeitiges Ansprechen von Konflikten
3. Prozessklarheit
- Transparente Rollen und Verantwortlichkeiten
- Klare Erwartungen und sichtbare Erfolge
- Schrittweise Begleitung von Veränderungen
Fazit: Eine neue Führungskultur
Führen mit Blick auf unser Nervensystem bedeutet, im Einklang mit unserer biologischen Natur zu handeln. Die Polyvagal-Theorie verschafft uns ein tieferes Verständnis davon, wie wir als Menschen „ticken“. Der erste Schritt ist dabei oft der wichtigste: Beginne damit, die verschiedenen Zustände bei dir und deinem Team bewusst wahrzunehmen. Hol dir dazu Unterstützung, von jemandem, der neurosensibel arbeitet.
Denn eines ist sicher: Die Zukunft der Führung in einer komplexen und volatilen Welt liegt nicht in noch mehr Tools und Struktur, sondern in einem tieferen Verständnis der menschlichen Natur.




